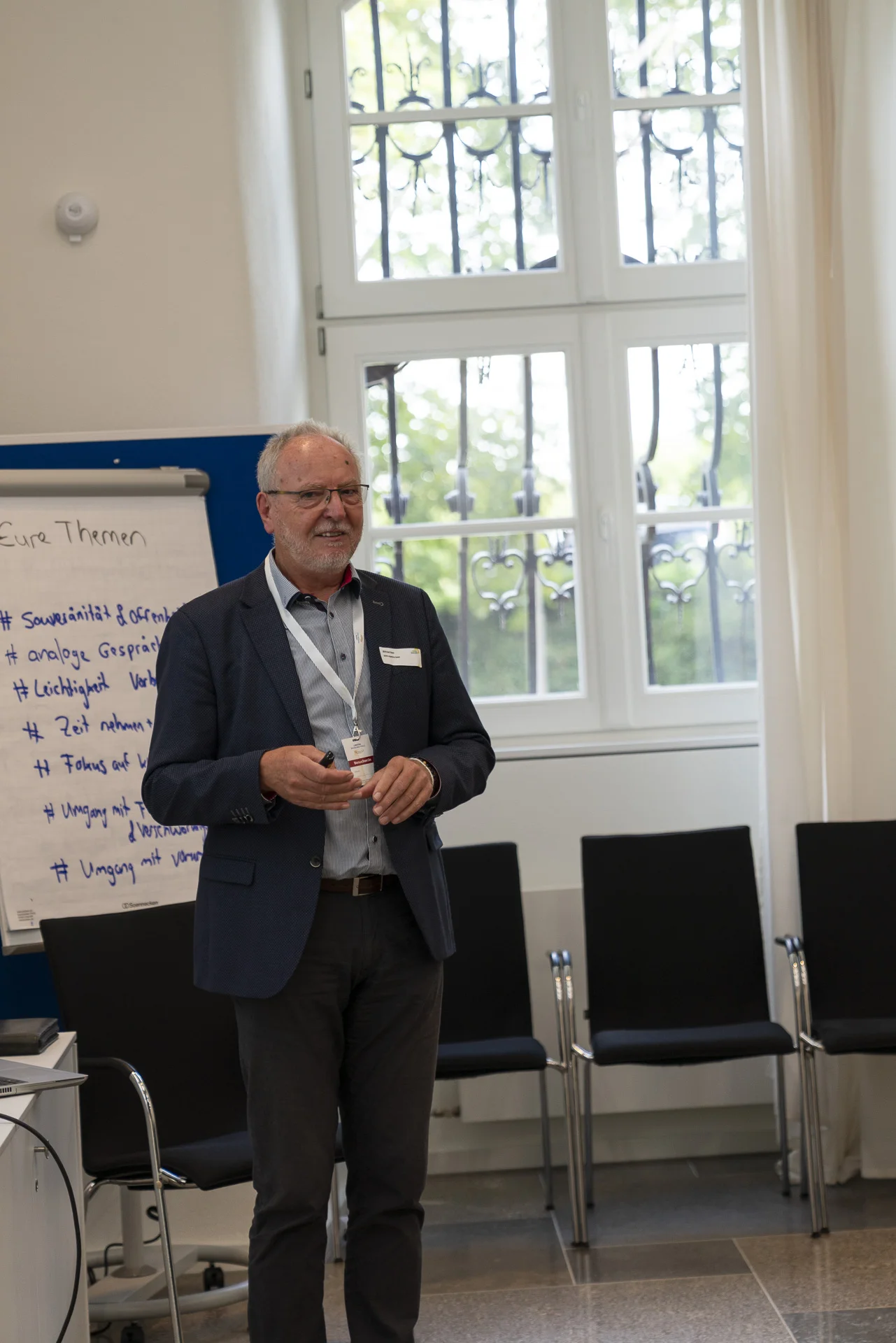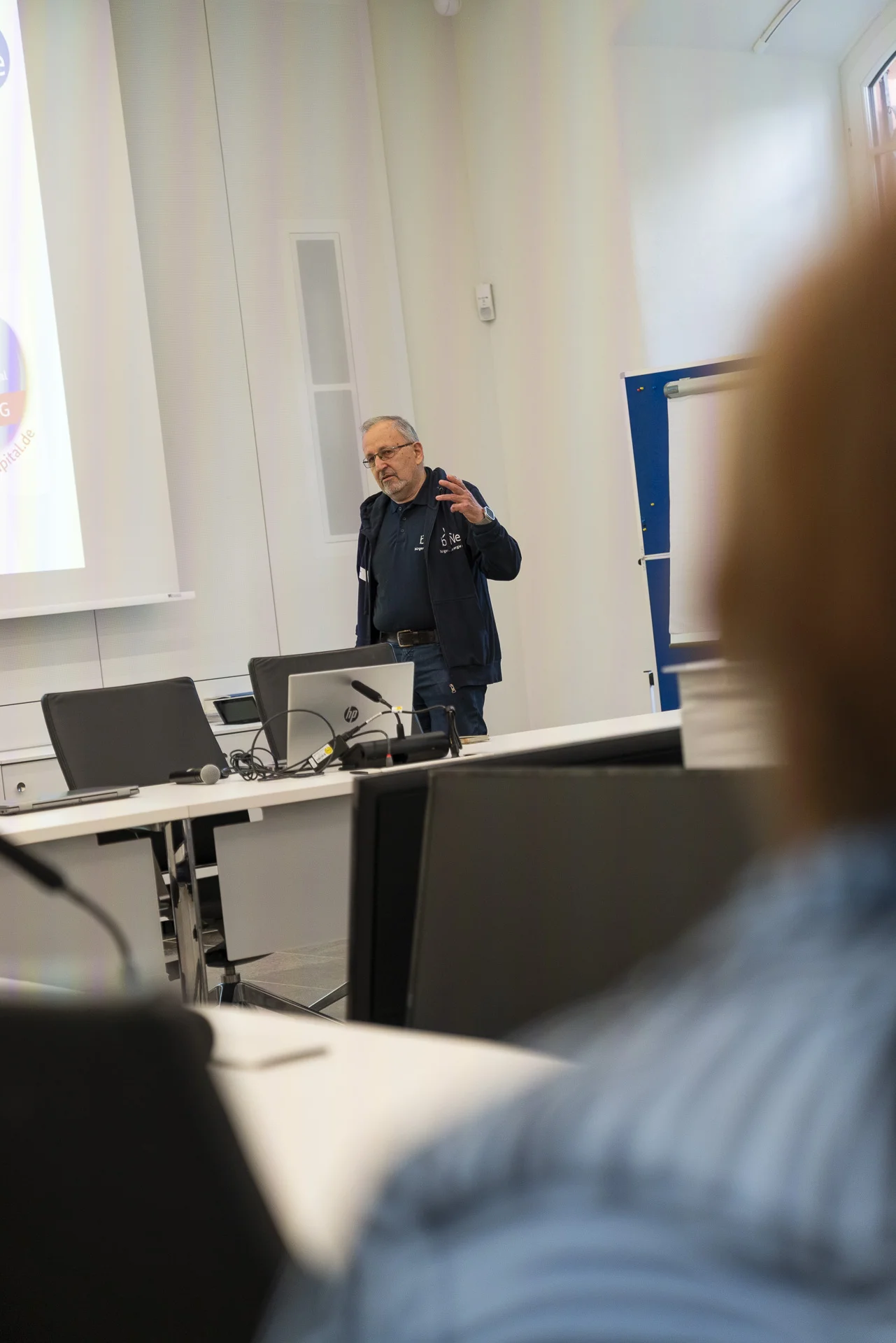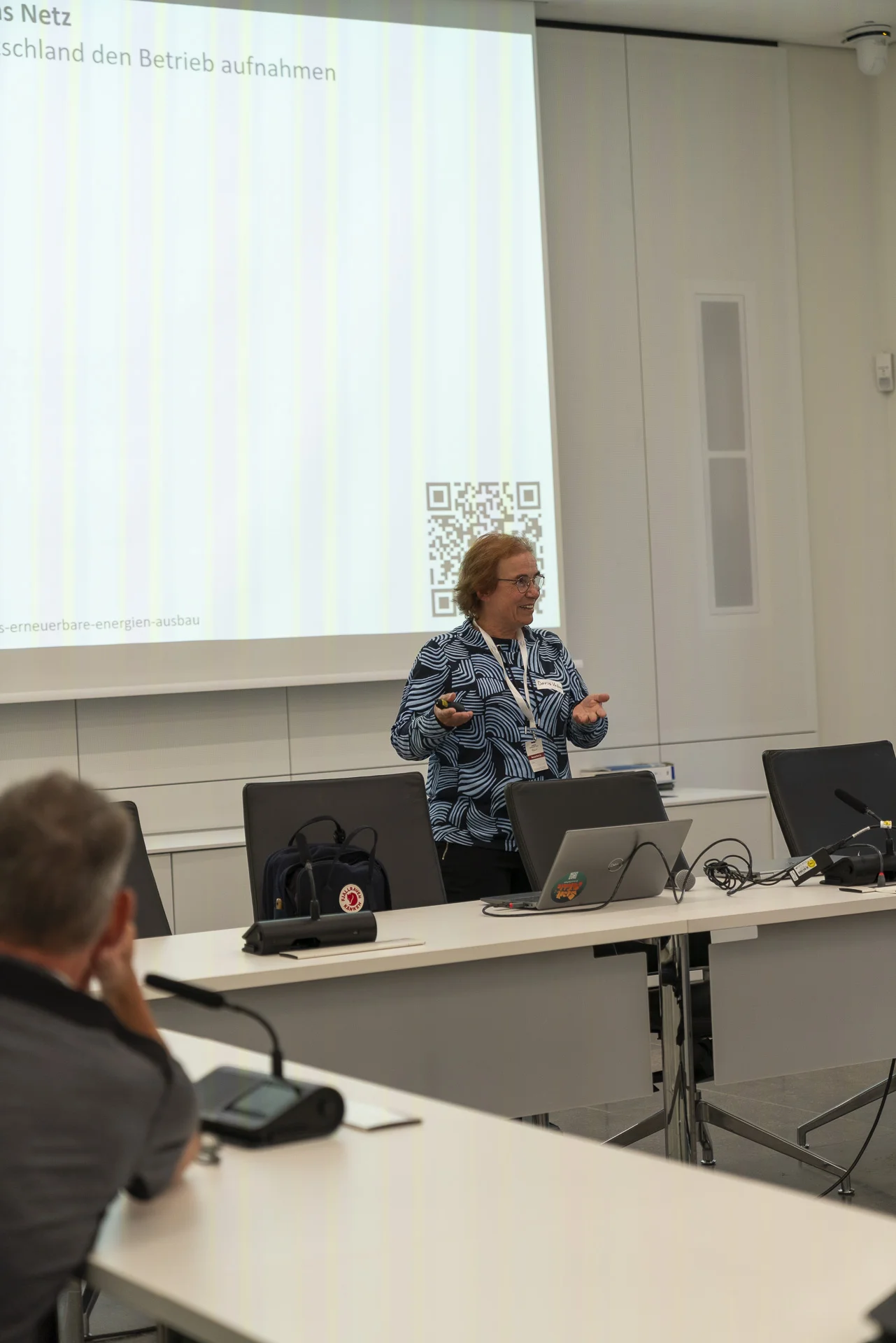Pia Schellhammer, Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag, machte bei der Eröffnung klar: Klimaschutz ist in Rheinland-Pfalz längst Alltag und die Energiewende ein Gemeinschaftsprojekt. Kommunen, Bürgerinitiativen und engagierte Unternehmen tragen längst zum Wandel bei. Der Kongress bot ihnen Raum, ihre Erfahrungen und Ideen zu teilen.
Politischer Rahmen mit klarer Richtung
Die Keynote von Katrin Eder, Klimaschutzministerin von Rheinland-Pfalz, machte unmissverständlich klar, wie ernst die Lage ist – und wie konsequent das Land auf die Herausforderungen der Klimakatastrophe reagiert. Besonders betroffen durch Extremwetterereignisse, wie die Flutkatastrophe 2021, sei Rheinland-Pfalz heute stärker denn je gefordert. Eder betonte, dass Anpassung allein nicht ausreiche. Genau deswegen wurde das Klimaschutzgesetz des Landes geschaffen.
Ziel ist es, den Bruttostrombedarf bis 2030 vollständig aus erneuerbaren Energien zu decken. Das Gesetz sei ambitioniert, aber notwendig. Die Ministerin hob hervor, dass die Natur nicht mehr automatisch für Ausgleich sorge. Der Mensch müsse Verantwortung übernehmen und Systeme aktiv umbauen. Dazu gehöre auch, den Ausbau der Wind- und Solarenergie mit dem Naturschutz in Einklang zu bringen. Beides könne sich ergänzen, wenn gut geplant werde.
Eder berichtete von konkreten Fortschritten: Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung liege mittlerweile bei 66 Prozent. Das seien mehr als dreimal so viel wie noch 2010. Gleichzeitig sei es gelungen, die durchschnittliche Genehmigungsdauer für Windkraftanlagen deutlich zu senken: von über 39 Monaten auf nun 16,6 Monate. Diese Beschleunigung sei zentral, um die Ausbauziele überhaupt erreichen zu können. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Flächennutzung. Eder kündigte an, künftig verstärkt große versiegelte Flächen wie Parkplätze für Photovoltaikanlagen zu nutzen.
Besonders betonte Eder, dass viele Menschen bereit seien, mitzugehen, wenn sie frühzeitig eingebunden und gut beraten würden. Das Programm KIPKI, mit dem 250 Millionen Euro an Investitionen ausgelöst wurden, habe gezeigt, wie stark Kommunen sich engagieren, wenn sie die richtigen Werkzeuge an die Hand bekommen.
Eder warnte zudem vor einem möglichen politischen Rollback. Die Erderhitzung vollziehe sich schleichend, sei aber real und werde das Leben vieler Menschen drastisch verändern, wenn man nicht gegensteuere. Geschichten des Gelingens seien jetzt entscheidend und genau das wolle Rheinland-Pfalz mit seiner Klimapolitik liefern.
Wissenschaft warnt: Das Zeitfenster wird enger
Prof. Dr. Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, machte in seinem Vortrag eindrücklich deutlich, warum beim Klimaschutz keine Zeit mehr zu verlieren ist. Die Temperaturanstiege der letzten Jahrzehnte seien dramatisch – und die Folgen längst spürbar: Hitzetote, Ernteausfälle, überlastete Infrastrukturen.
Quaschning betonte, dass technologische Lösungen vorhanden seien. Was fehle, sei politische Klarheit und eine ehrliche Debatte über Prioritäten. Statt vager Begriffe wie „Technologieoffenheit“ brauche es klare Entscheidungen zugunsten effizienter Lösungen wie Wärmepumpen, Solarstrom und Elektromobilität. Auch gesellschaftlich müsse der Wandel besser kommuniziert werden. Klimaschutz sei nicht nur Verzicht, sondern auch Innovation, regionale Wertschöpfung und Lebensqualität.
Praxis, Handwerk und Beteiligung – viele Wege, ein Ziel
In der Podiumsdiskussion, die vom energie- und klimapolitischen Sprecher der GRÜNEN Landtagsfraktion Fabian Ehmann moderiert wurde, trafen unterschiedliche Perspektiven aufeinander, die zeigten, wie vielfältig, aber auch herausfordernd die Umsetzung der Energiewende ist. Auf dem Podium saßen Katrin Eder, Klimaschutzministerin von Rheinland-Pfalz, Prof. Volker Quaschning, Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie, Michael Blug, Landesbezirksleiter der Gewerkschaft ver.di für Rheinland-Pfalz und das Saarland sowie Oliver Saling, Landesinnungsmeister des Fachverbands Sanitär Heizung Klima Rheinland-Rheinhessen und Obermeister der SHK-Innung Mainz.
Zum Auftakt wurden positive Entwicklungen der letzten Monate angesprochen, darunter der gestiegene Anteil Erneuerbarer Energien und der wachsende Rückhalt für Klimaschutz auf kommunaler Ebene. Die Diskussion zeigte dann schnell, wie groß die Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität weiterhin sind.
Katrin Eder stellte klar, dass das Landesklimaschutzgesetz bewusst ambitioniert ausgelegt wurde. Trotz verhaltener öffentlicher Reaktionen sei das Gesetz ein wichtiges Signal, auch in einem schwierigen bundespolitischen Umfeld. Besonders im Verkehrssektor gebe es noch viele ungenutzte Potenziale.
Volker Quaschning warnte vor einem schleichenden Rückbau klimapolitischer Ambitionen. Die Studierendenzahlen in den Energiefächern seien rückläufig. Dies sei ein deutliches Zeichen für eine fehlende positive Erzählung in der Bundespolitik. Er forderte mehr Aufbruchsstimmung, klare Signale und eine Kommunikation, die Chancen statt Blockaden betont.
Simone Peter verwies auf den aktuellen Monitoringbericht der Bundesregierung und betonte die Bedeutung verlässlicher Rahmenbedingungen. Die Unternehmen seien bereit, in grüne Technologien zu investieren, sofern die politischen Leitplanken stimmen. Ein Roll-back müsse verhindert werden, indem man das bisher Erreichte nicht infrage stelle, sondern weiter ausbaue.
Oliver Saling machte deutlich, dass das Handwerk seine Hausaufgaben gemacht habe. Nun sei die Politik am Zug. Gerade beim Thema Wärmepumpen führe die wechselhafte Förderpolitik zu großer Verunsicherung. Die Betriebe bräuchten Planungssicherheit und einen verlässlichen Dialog, wie ihn die Landesregierung nach der Ahrkatastrophe vorbildlich geführt habe.
Michael Blug richtete den Blick auf die arbeitsmarktpolitische Dimension. Der ÖPNV etwa biete Potenzial für zehntausende neue Arbeitsplätze, wenn die Finanzierung gesichert sei. Auch die Transformation der Stahlindustrie sei möglich, jedoch nur bei stabilen CO2-Zertifikatspreisen. Blug warnte: Werden diese Preise gedrückt, droht das Aus für grüne Industrien und damit auch für viele Arbeitsplätze.
Auch Themen wie Fachkräftemangel, Bildung, Passivhäuser und die Rolle von Unternehmen im Klimaschutz kamen zur Sprache. Saling forderte mehr Wertschätzung für das Handwerk und eine Stärkung der Berufsschulen. Quaschning und Peter unterstrichen, dass wirtschaftliche Anreize wichtig sind. Viele Menschen seien bereit, mitzumachen, wenn sie auch finanziell profitieren. Blug wies darauf hin, dass die soziale Absicherung beim Wandel nicht vergessen werden dürfe.
Das Publikum brachte zudem Fragen zu Merit Order, Smart Meter, Energiepreiszonen und ökonomischen Anreizen ein. Insgesamt zeigte die Diskussion: Die Energiewende ist kein Selbstläufer, aber sie kann gelingen, wenn Politik, Gesellschaft und Wirtschaft an einem Strang ziehen.
Markt der Möglichkeiten – der Wandel zum Anfassen
Neben Vorträgen und Diskussionen zeigte der Markt der Möglichkeiten, wie konkret Energiewende schon heute ist. Unternehmen, Initiativen und Vereine präsentierten ihre Projekte – von Windkraft über Solarenergie bis hin zu digitalen Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit dabei waren unter anderem Gedea Ingelheim, RaBE Rabenkopf Bürgerenergie, BürgerIn-Energie, LaNEG e.V., Agrario Energy, die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Scientists for Future, der Landesverband Erneuerbare Energie RLP/Saar, der Bundesverband Windenergie, Green Mama Solutions und Qualitas Energy.
Viele zeigten: Beteiligung wirkt. Wenn Bürger:innen sich einbringen können – finanziell oder durch Mitsprache –, steigt die Akzeptanz.
Fazit: Jetzt gemeinsam weitermachen
„Klimaschutz durch Energiewende“ – der Kongress hat gezeigt, dass Rheinland-Pfalz diesen Weg entschlossen geht. Die politische Richtung stimmt, die wissenschaftliche Analyse drängt, und aus der Praxis kommt Rückenwind. Klar ist aber auch: Der Wandel gelingt nur gemeinsam: mit Verlässlichkeit, Beteiligung und Mut zur Entscheidung.
Der Kongress hat dafür wichtige Impulse gesetzt. Jetzt kommt es darauf an, dass daraus konkretes Handeln wird, in den Kommunen, in der Landespolitik und im Alltag.